Habari zenu
Hoffe euch geht es gut und entschuldige mich im gleichen Zuge für die lange Pause des Schreibens , aber es passierte so viel in letzter Zeit, dass ich keine Zeit fand mich hinzusetzten und zu schreiben.
Hoffe euch geht es gut und entschuldige mich im gleichen Zuge für die lange Pause des Schreibens , aber es passierte so viel in letzter Zeit, dass ich keine Zeit fand mich hinzusetzten und zu schreiben.
Warum ich jetzt
Zeit finde erklärt sich recht einfach …
seit dem letzten Donnerstag ist „Closing Time“ in Mbagathi und nahezu alle Einheimischen sind zu ihren Familien zurückgekehrt um die Weihnachtzeit mit den ihrigen zu verbringen.
Demnach ist der in Kenia als so ehrwürdig angesehene Job des „Watchmans“, welcher eigentlich nicht viel mehr als einen Pförtner darstellt, mir für diesen Morgen zugefallen. Da auf Station gerade nicht al zu viel los ist habe ich also endlich Zeit zu berichten was mich die letzten Wochen so geschäftig hielt.
seit dem letzten Donnerstag ist „Closing Time“ in Mbagathi und nahezu alle Einheimischen sind zu ihren Familien zurückgekehrt um die Weihnachtzeit mit den ihrigen zu verbringen.
Demnach ist der in Kenia als so ehrwürdig angesehene Job des „Watchmans“, welcher eigentlich nicht viel mehr als einen Pförtner darstellt, mir für diesen Morgen zugefallen. Da auf Station gerade nicht al zu viel los ist habe ich also endlich Zeit zu berichten was mich die letzten Wochen so geschäftig hielt.
Wo ich gerade
darüber nachdenke, was nach dem letzten Bericht so passiert ist, fällt mir auf
wie lang ich schon nichts mehr postete.=)
Magadi
Einer unserer Wochenendausflüge führte uns nach Magadi. Dies ist das magische Wort für einen malerischen Ort zu dem es alle möglichen Digunamenschen immer wieder zieht.
Im Prinzip handelt es sich um einen abgelegenen Ort an dem heißes Wasser aus einer Quelle kommt und an einer Stelle eine natürliche Badewanne bildet.Wir hatten eine sehr schöne zeit inmitten Gottes Natur.
Magadi
Einer unserer Wochenendausflüge führte uns nach Magadi. Dies ist das magische Wort für einen malerischen Ort zu dem es alle möglichen Digunamenschen immer wieder zieht.
Im Prinzip handelt es sich um einen abgelegenen Ort an dem heißes Wasser aus einer Quelle kommt und an einer Stelle eine natürliche Badewanne bildet.Wir hatten eine sehr schöne zeit inmitten Gottes Natur.
Ich glaube irgendwann
nach Magadi, also Anfang November, fing die Campzeit an. Welche den
Stationsalltag doch deutlich abänderte.
Als Camps werden hier einwöchige Freizeiten auf Station bezeichnet, an welchen um die 200 13- bis 20-jährige Jungs und Mädchen unterschiedlichster Lager teilnehmen.
Eine wunderbare Zeit, um Jugendliche zu erreichen, Beziehungen zu knüpfen, Irrlehren aus jungen Köpfen zu streichen und abertausende Fragen über Deutschland zu beantworten: „Stimmt es, dass Deutsche Geld für das Essen ihres Hundes ausgeben?“ So oder so ähnlich sah es dabei aus. Obwohl man dabei sehr vorsichtig sein musste, denn wenn man erzählte , dass es in Deutschland Möglichkeiten gäbe, bei denen man Geld verdienen und gleichzeitig einen Beruf erlernen konnte, wollten dann doch die meisten der Zuhörer auswandern. Das ist darauf zurückzuführen, dass die größte Sorge der meisten kenianischen Familien ist, dass sie eines Tages das Schulgeld nicht mehr bezahlen könnten.
Aber rückblickend muss ich sagen, dass die Camps doch eine recht segensreiche, wenn auch ziemlich anstrengende Zeit war da sie sich über 5 Wochen aneinander reihten und wenig Zeit zum Ruhen ließen.
Als Camps werden hier einwöchige Freizeiten auf Station bezeichnet, an welchen um die 200 13- bis 20-jährige Jungs und Mädchen unterschiedlichster Lager teilnehmen.
Eine wunderbare Zeit, um Jugendliche zu erreichen, Beziehungen zu knüpfen, Irrlehren aus jungen Köpfen zu streichen und abertausende Fragen über Deutschland zu beantworten: „Stimmt es, dass Deutsche Geld für das Essen ihres Hundes ausgeben?“ So oder so ähnlich sah es dabei aus. Obwohl man dabei sehr vorsichtig sein musste, denn wenn man erzählte , dass es in Deutschland Möglichkeiten gäbe, bei denen man Geld verdienen und gleichzeitig einen Beruf erlernen konnte, wollten dann doch die meisten der Zuhörer auswandern. Das ist darauf zurückzuführen, dass die größte Sorge der meisten kenianischen Familien ist, dass sie eines Tages das Schulgeld nicht mehr bezahlen könnten.
Aber rückblickend muss ich sagen, dass die Camps doch eine recht segensreiche, wenn auch ziemlich anstrengende Zeit war da sie sich über 5 Wochen aneinander reihten und wenig Zeit zum Ruhen ließen.
Im zweiten
Camp hatte ich die Aufgabe, eine
Wanderung mit einer Gruppe von Jugendlichen zu machen, und das 4 Tage die
Woche, was meine Beine dann doch etwas strapazierte. Eine Begebenheit während
dieser Wanderungen möchte ich mit euch teilen:
Am dritten Tage, nachdem mir die Route, die wir gingen, doch arg öde geworden war, entschied ich mich diese einmal abzuändern. Ich schaute auf Google Maps und fand einen Rundweg
(bis dato waren wir immer nur einen Weg hin und den gleichen wieder zurück gewandert). Also ich fand zwei Wege, die sich auf der Karte ziemlich nahe kamen, und demnach entschied ich den Weg zwischen diesen beiden einfach selbst zu suchen.
Also gingen wir den Weg, welchen ich im Vorhinein erwählte und alle vertrauten auf meine Weg-Führungsqualitäten. Meine Aufgabe war also so zu tun als wüsste ich den Weg, was aber nach kurzer Zeit nicht mehr der Fall war, denn Google sagte mir an, einen Fluss zu überqueren, welcher aber einfach nicht da war. Von nun an führte ich also nach Gefühl.
Dieses leitete mich dann schlussendlich doch noch zu dem besagten Fluss, oder besser Bach, und die Überquerungsstelle bot mir folgenden Anblick: ein sieben Meter ziemlich zerlegter Abhang tat sich auf, an dessen Ende das Bachufer auf uns wartete. Das Problem war, dass wir diese Stelle, welche eigentlich der Viehtränken bedacht war, völlig durchnässt vorfanden, da es kürzlich erst heftigst geregnet hatte. So stand uns also eine ordentliche Rutschpartie bevor.
Solche Situationen bin ich aus dem Bergischen gewohnt und schnappte mir die Hand des ersten und begann langsam meine Longboard-Fähigkeiten auf Schlammabfahrt anzupassen. So bildete ich mit den ersten 10 Leuten eine Schlange, die sich gegenseitig stützte und wir erreichten ohne einen einzigen Schritt zu tätigen das Ufer.
Die Mädchengruppe, welche unserer Technik zuerst nicht zu trauen schien, sich dann aber nach der Erfolgserkenntnis selbst aus den Weg begab, nutzte auch die Möglichkeit, sich gegenseitig halten zu können.
Als dann aber die erste hinfiel wurde das Feature zum Bug und alle ließen sich eine schlammige Rutschpartie gefallen. Also alle außer die Rutschenden selber. Triefend vor Schlamm aber lebendig kamen wir also auf der anderen Seite des Baches den Hügel hinauf gestapft und fanden dann auch den erhofften Weg, mussten aber erschreckenderweise feststellen, dass wir uns im Nairobi National Park befanden. Aber da sich die Gazellen genauso wenig an uns wie wir an ihnen störten, war das kein Problem, denn nach wenigen Metern kamen wir auch schon an die ersten Ausläufer der Vorbezirke Nairobis. Trotz der durchnässten Kleider herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den Campern und gute Gespräche sind nach solch einem gemeinsamen Erlebnis besser und tiefer.
Am dritten Tage, nachdem mir die Route, die wir gingen, doch arg öde geworden war, entschied ich mich diese einmal abzuändern. Ich schaute auf Google Maps und fand einen Rundweg
(bis dato waren wir immer nur einen Weg hin und den gleichen wieder zurück gewandert). Also ich fand zwei Wege, die sich auf der Karte ziemlich nahe kamen, und demnach entschied ich den Weg zwischen diesen beiden einfach selbst zu suchen.
Also gingen wir den Weg, welchen ich im Vorhinein erwählte und alle vertrauten auf meine Weg-Führungsqualitäten. Meine Aufgabe war also so zu tun als wüsste ich den Weg, was aber nach kurzer Zeit nicht mehr der Fall war, denn Google sagte mir an, einen Fluss zu überqueren, welcher aber einfach nicht da war. Von nun an führte ich also nach Gefühl.
Dieses leitete mich dann schlussendlich doch noch zu dem besagten Fluss, oder besser Bach, und die Überquerungsstelle bot mir folgenden Anblick: ein sieben Meter ziemlich zerlegter Abhang tat sich auf, an dessen Ende das Bachufer auf uns wartete. Das Problem war, dass wir diese Stelle, welche eigentlich der Viehtränken bedacht war, völlig durchnässt vorfanden, da es kürzlich erst heftigst geregnet hatte. So stand uns also eine ordentliche Rutschpartie bevor.
Solche Situationen bin ich aus dem Bergischen gewohnt und schnappte mir die Hand des ersten und begann langsam meine Longboard-Fähigkeiten auf Schlammabfahrt anzupassen. So bildete ich mit den ersten 10 Leuten eine Schlange, die sich gegenseitig stützte und wir erreichten ohne einen einzigen Schritt zu tätigen das Ufer.
Die Mädchengruppe, welche unserer Technik zuerst nicht zu trauen schien, sich dann aber nach der Erfolgserkenntnis selbst aus den Weg begab, nutzte auch die Möglichkeit, sich gegenseitig halten zu können.
Als dann aber die erste hinfiel wurde das Feature zum Bug und alle ließen sich eine schlammige Rutschpartie gefallen. Also alle außer die Rutschenden selber. Triefend vor Schlamm aber lebendig kamen wir also auf der anderen Seite des Baches den Hügel hinauf gestapft und fanden dann auch den erhofften Weg, mussten aber erschreckenderweise feststellen, dass wir uns im Nairobi National Park befanden. Aber da sich die Gazellen genauso wenig an uns wie wir an ihnen störten, war das kein Problem, denn nach wenigen Metern kamen wir auch schon an die ersten Ausläufer der Vorbezirke Nairobis. Trotz der durchnässten Kleider herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den Campern und gute Gespräche sind nach solch einem gemeinsamen Erlebnis besser und tiefer.
Das letzte Camp des
Jahres war ein sogenanntes external (Externes) Camp. Welches eigentlich nur
heißt, dass Diguna ein kleines Team von Mitarbeitern aussendet um bei einem von irgendeiner Kirche organisierten
Camp mitzuarbeiten. Für die Youth ministry hieß das: auf an die Küste in das
Land der Samburu(Stamm). Die Camps dort sind für uns echt unvorstellbar. Die Planung
sah 3 Predigten und 3 Bibelarbeiten pro Tag vor, was bei solchen Camps Standard
ist. Und da kommt Diguna ins Spiel. Wir sorgten dafür, dass weniger gepredigt
und mehr gespielt wurde um den Campern auch Möglichkeit zur sozialen Interaktion
zu geben. Hierbei kam ich wohl endgültig zu der Erkenntnis, dass es für Menschen
wie mich, die die Sprache der Einheimischen nicht beherrschen, jegliche Art der
Evangelisation fast unmöglich ist. Einerseits konnten die wenigen die Englisch
konnten wegen meiner für sie so ungewohnten Aussprache nichts verstehen
andererseits trauten sich die meisten gar nicht, mir als Weißem überhaupt ins
Gesicht zu schauen. Ich schäme mich für das Bild welches jeglicher weißer
Mensch zuvor auf eine dieser Personen abgegeben hat . Aber grade daher freue
ich mich umso mehr, mich so viel praktisch einbringen zu können. Denn Reparaturen
finden in diesem Land nie ein Ende und somit bin ich doch sehr hilfreich in
vielen unterschiedlichen Stellen.
Nach dem Camp wurden wir von einem Mitarbeiter namens Salim (Ja, er war Muslim bevor er sich bekehrte) zu sich nach Hause nach Mombasa eingeladen. Spontan nahmen wir an, was hieß, dass sich ein Einheimischer aus Mombasa mit 4 Deutschen und einem Nairobi-Kenianer auf dem Weg an den indischen Ozean machte. Normalerweise sieht ein Mombasa Urlaub sehr strand- und ruhelastig aus, sodass man nachts in seinem Bett einkehrt und vor lauter Inaktivität noch schnell ein Schweißbad im eignen Bett vollführt. Aber unserer kam glücklicherweise anders. Salim hatte gerade Semesterferien und demnach viel Zeit uns alles zu zeigen, was er als wichtig erachtete. Dies hieß, was ich sehr begrüßte, dass wir eine kulinarische Rundreise in der Küstenstadt machten um unter Schau zu stellen, dass Kenianer mehr als Mais und Bohnen kennen und können. Diese Beweisführung hat mich in den Genuss unterschiedlichster Köstlichkeiten vom Straßenrand gebracht, die mich alle hellauf begeisterten. Zum Beispiel panierte, frittierte Kartoffelstückchen mit Kokosnuss und Porridge (so etwas wie Grießbrei). Das wichtigste dabei ist einfach, dass die Mombassarianer Gewürze mögen und benutzen, was uns natürlich ungemein zusagte, da wir im Externalcamp vorher eine Woche nur ungewürzte Bohnen, Mais und Reis aßen. Wir besuchten interessante Orte wir das UNESCO Weltkulturerbe Fort Jesus, die schlichte Nichtexistenz von Brücken in Mombasa, weswegen völlig überfüllte Fähren den Verkehr regeln, eine Kirche im Moscheekleid und und und. Außerdem aßen wir bei Moslems zuhause ganz swahilisch auf dem Boden oder erlebten, wie in einem Restaurant auf einmal das gesamte Personal fehlte, da dieses zu Beten aufgerufen wurde. Mich beeindruckte, ganz entgegen meiner Mombasa Assoziation, das friedliche Zusammenleben beider Religionen. Frieden auch in der Hinsicht, dass man selbst schon wenn es dunkel ist noch Kinder beim Spielen auf den Straßen hat. In Nairobi währe selbiges ein Ding der Unmöglichkeit, wegen der starken Kriminalität.
 |
| Eine Kröte mit Schnapp und Schild gerüstet kreuzte unseren Weg |
 |
| Da Stromausfall herrschte, kappten wir den Stromanschluss und steckten die beiden Litzen in eine Mehrfachsteckdosenleiste, welche vom Generator angetrieben wurde: Abenteuerlich aber effizient . |
Nach dem Camp wurden wir von einem Mitarbeiter namens Salim (Ja, er war Muslim bevor er sich bekehrte) zu sich nach Hause nach Mombasa eingeladen. Spontan nahmen wir an, was hieß, dass sich ein Einheimischer aus Mombasa mit 4 Deutschen und einem Nairobi-Kenianer auf dem Weg an den indischen Ozean machte. Normalerweise sieht ein Mombasa Urlaub sehr strand- und ruhelastig aus, sodass man nachts in seinem Bett einkehrt und vor lauter Inaktivität noch schnell ein Schweißbad im eignen Bett vollführt. Aber unserer kam glücklicherweise anders. Salim hatte gerade Semesterferien und demnach viel Zeit uns alles zu zeigen, was er als wichtig erachtete. Dies hieß, was ich sehr begrüßte, dass wir eine kulinarische Rundreise in der Küstenstadt machten um unter Schau zu stellen, dass Kenianer mehr als Mais und Bohnen kennen und können. Diese Beweisführung hat mich in den Genuss unterschiedlichster Köstlichkeiten vom Straßenrand gebracht, die mich alle hellauf begeisterten. Zum Beispiel panierte, frittierte Kartoffelstückchen mit Kokosnuss und Porridge (so etwas wie Grießbrei). Das wichtigste dabei ist einfach, dass die Mombassarianer Gewürze mögen und benutzen, was uns natürlich ungemein zusagte, da wir im Externalcamp vorher eine Woche nur ungewürzte Bohnen, Mais und Reis aßen. Wir besuchten interessante Orte wir das UNESCO Weltkulturerbe Fort Jesus, die schlichte Nichtexistenz von Brücken in Mombasa, weswegen völlig überfüllte Fähren den Verkehr regeln, eine Kirche im Moscheekleid und und und. Außerdem aßen wir bei Moslems zuhause ganz swahilisch auf dem Boden oder erlebten, wie in einem Restaurant auf einmal das gesamte Personal fehlte, da dieses zu Beten aufgerufen wurde. Mich beeindruckte, ganz entgegen meiner Mombasa Assoziation, das friedliche Zusammenleben beider Religionen. Frieden auch in der Hinsicht, dass man selbst schon wenn es dunkel ist noch Kinder beim Spielen auf den Straßen hat. In Nairobi währe selbiges ein Ding der Unmöglichkeit, wegen der starken Kriminalität.
.

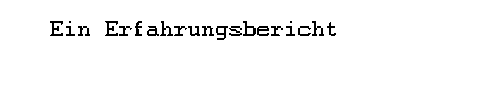







Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen